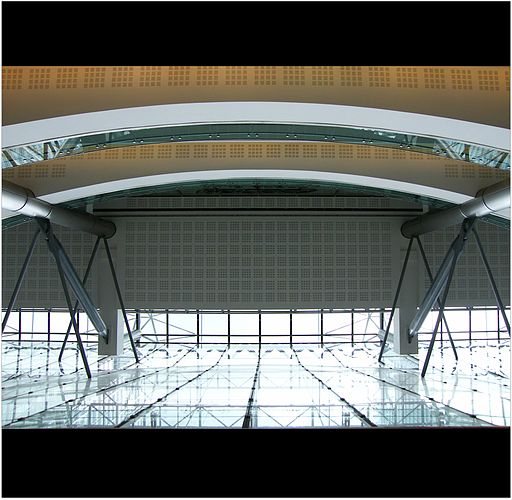Cassirer versteht Raum und Zeit als die beiden zentralen Komponenten „des architektonischen Baues der Erkenntnis“[1] überhaupt. Erkenntnis kann erst dann gewonnen werden, wenn die Wahrnehmung der gegenwärtig in der Welt befindlichen Dinge um die Miteinbeziehung der geschichtlichen Relevanz von Raum und Zeit für das Wie eben dieser Objekte/Welt ergänzt wird. Je tiefer die Erkenntnis in die Strukturen von Raum und Zeit eindringt, desto eher erfasst sie ihre eigenen Voraussetzungen und Prinzipien; dabei sind Raum und Zeit gegenständliches Korrelat und Gegenhalt zu der Erkenntnis.
Um diese Einsicht zu bestätigen und zu erweitern, schlägt Cassirer vor, verschiedene Grundformen geistiger Gestaltung unter die Lupe zu nehmen – eben im Bewusstsein dessen, dass vorderhand die Grundfrage nach Form von Raum und Zeit geklärt oder zumindest gestellt werden muss. Die Kunstwissenschaft muss also Wesen des Raums und räumlicher Darstellung klären.
Am Beginn steht „die räumliche Vorstellung im allgemeinen und die Formvorstellung als die des begrenzten Raumes im besonderen“[2] als – im Wesentlichen – Realität, da Mensch sich auf diese Art und Weise in der Außenwelt orientiert.
Alle Erscheinungen sind – bedenkt man die wechselnde Erscheinung des Raumes – nur Ausdrucksbilder menschlicher räumlicher Vorstellung. In diesem Kontext hinterfragt Cassirer grundsätzlich das Prinzip künstlerischer Gestaltung. Er verleiht der Hoffnung Ausdruck, „daß gerade das Raumproblem zum Ausgangspunkt einer neuen ‚Selbstbesinnung’ der Ästhetik werden könne“[1]. Er erhofft sich neue Möglichkeiten für künstlerische Gestaltung.
Seinen Überlegungen legt er die epistemologische Grundtendenz der Beschäftigung mit Raum seiner Zeit zugrunde; nämlich den Vorrang des Ordnungsbegriffs vor dem Seinsbegriff. Er unterstreicht zwar, dass dem Raum ein Sein zukommt/zukommen muss – ganz einfach aus der Tatsache heraus, dass wir über ihn „sprechen“. Aber viel weiter meint Cassirer auch schon nicht gehen zu können. „Denn es liegt in der phänomenologischen Eigenart, in dem einfachen Befund des Raumes, wie in dem der Zeit begründet, daß das Sein beider mit dem Sein der ‚Dinge’ nicht gleichbedeutend, sondern spezifisch von ihm verschieden ist.“[2] Dementsprechend „akzeptiert“ Cassirer das Sein sowohl der Dinge, als auch jenes von Raum und Zeit subsumierend nur mehr als Scheineinheit unter eben diesem Begriff.
Cassirer nimmt sich in vorliegendem Fall nicht die Zeit, die Dialektik dieses Problems auszuführen. Durch Anwendung der Kantschen Kategorie des Dinges spricht er dem Raum eigenständiges Sein, eigenständige Substanz ab. Der metaphysischen Kategorie Substanz überordnend, gesteht er Raum allerdings eine Ordnungsfunktion zu. Erst durch die Begriffe Relation, Beziehung, Ordnung könne man Raum und Zeit widerspruchs- und nahtlos in das System der Erkenntnis einfügen.
Raum und Zeit sind also keine Dinge, sondern Ordnungen. „Raum und Zeit sind keine Substanzen, sondern vielmehr ‚reale Relationen’; sie haben ihre wahrhafte Objektivität in der ‚Wahrheit von Beziehungen’, nicht an irgend einer absoluten Wirklichkeit.“[3]
An dieser Stelle kehrt Cassirer wieder zu seiner ursprünglichen Fragestellung künstlerischer Anschauung und Gestaltung zurück. Entbehren diese vorangestellten metaphysischen Überlegungen nicht jeglicher Relevanz für das Ästhetische? Oder ist künstlerische Gestaltung gar nicht so selbständig, so autark wie gemeinhin angenommen? Wenig überraschend beantwortet Cassirer diese Frage selbst, und argumentiert, dass der Übergang vom Seinsbegriff zum Ordnungsbegriff natürlich auch die Kunst nicht unberührt lässt, ganz einfach deswegen, weil sich dieser Paradigmenwechsel in den Köpfen – der gestaltenden Menschen – nicht ausblenden lässt.
Die Mannigfaltigkeit der Dinge, die innere Vielgestaltigkeit der Ordnung ist für diese selbst geradezu Lebenselement. Cassirer attestiert Vielheit und Ordnung eine analoge Korrelation, und verbindet somit den „Aufstieg“ des Ordnungsbegriffs auch als „Sieg des Pluralismus […], der Vielförmigkeit“[4]. Durch die Ordnung, die Pluralität zulässt – im Gegensatz zum bloßen Sein, „in dem die Sachen sich stoßen, einander zu befehden und einander auszuschließen scheinen“[5] – und damit indirekt sogar fördert, können verschiedenartigste geistige Gebilde beieinander wohnen.
Die Denkfunktion, das Unbegrenzte zu begrenzen und damit zu binden, ermöglicht – und an diesem Punkt eröffnet sich auch eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten für Kunst – „der Übergang […] vom Fluß der Erscheinung in das Reich der reinen Form“[6].
Cassirer beschwört also die Dialektik der Ordnung, die in der Kunst des Trennens sowie des Verknüpfens, des Scheidens sowie des (Wieder)zusammenführens ihren Ausdruck findet, und attestiert nicht nur dem theoretischen Begriff, sondern auch künstlerischer Anschauung und Gestaltung die Kraft, das Unbestimmte zur Bestimmung zu bringen. Sonderung, die zugleich Verknüpfung ist, vollzieht sich hier nicht nur durch die Medien Denken und theoretischer Begriff, sondern auch in jenem reiner Gestalt.
Es eröffnen sich ungeahnte Entfaltungsmöglichkeiten für die Gestaltung des Raumes/der Raum-Ordnung. Der Raum erhält demnach „seinen bestimmten Gehalt und seine eigentümliche Fügung erst von der ‚Sinnordnung’ […], innerhalb deren er sich jeweilig gestaltet“[7]. Und Cassirer führt weiter aus: „Der Raum […] gewinnt diese [seine; Anm.] Struktur erst kraft des allgemeinen Sinnzusammenhangs, innerhalb dessen sein Aufbau sich vollzieht.“[8]
Raum und seine Struktur sind also abhängige Variablen. Die prägnanteste formelle Bestimmung dafür entleiht Cassirer Leibniz: Raum als Möglichkeit des Beisammen und der dieser Möglichkeit immanenten Ordnung.
Cassirer geht sogar soweit, Raum mit einer diesen bestimmenden „mythischen Qualität“[9] aufzuladen, und ihn somit der definierenden, konstituierenden Charakteristika Rechts, Links, Oben, Unten, Nord, Ost, Süd, West, etc. zu berauben. Anstelle derer treten „magische Züge“ wie Heiligkeit/Unheiligkeit, Segen/Fluch, Vertrautheit/Fremdheit, etc. Und in diesem Kontext sind Vorgänge, Handlungen, Dinge, etc. räumlich fixiert und prädeterminiert.
Die Komponenten, die der menschlichen Erfahrungswelt entnommen werden, werden geordnet, gegeneinander abgesondert und mit Gefühlen mythischer Nuancierungen gleichgesetzt, vermischt und aneinander zugeordnet.
Zum (kurzen) Abschluss seiner Ausführungen kommt Cassirer doch noch auf den ästhetischen Raum zu sprechen; allerdings setzt er diesen mit dem mythischen Raum, dessen Struktur und dessen Schema geradezu gleich, sieht in als eigenen echten Lebensraum; der grundsätzlichste Unterschied besteht in der Produktionsweise, die keine rein gedankliche, sondern ergänzend dem Gefühl und der Phantasie entspringende ist. „So ist der ästhetische Raum […] ein Inbegriff möglicher Gestaltungsweisen, in deren jeder sich ein neuer Horizont der Gegenstandswelt aufschließt.“[10]
[1] Cassirer, Ernst; S. 487
[2] Cassirer, Ernst; S. 488
[3] Cassirer, Ernst; S. 489 f.
[4] Cassirer, Ernst; S. 492
[5] Cassirer, Ernst; S. 492
[6] Cassirer, Ernst; S. 492
[7] Cassirer, Ernst; S. 494
[8] Cassirer, Ernst; S. 494
[9] vgl. Cassirer, Ernst; S. 495
[10] Cassirer, Ernst; S. 499
Cassirer, Ernst (1931); Mythischer, ästhetischer und theoretischer Raum, in: Dünne, Jörg/ Günzel, Stephan (Hrsg.); Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften; Suhrkamp Taschenbuch Verlag; Frankfurt am Main, 2006; S. 485 – 500
—
© Headerfoto von || UggBoy♥UggGirl || PHOTO || WORLD || TRAVEL || [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons